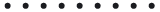Wie viel Arbeit braucht der Mensch?

Der Titel, zu dem ich hier ein paar Überlegungen vortragen soll, ist gut gewählt, denn er bringt mit nicht mehr als sechs Worten die vollkommene Absurdität unserer Arbeitsverhältnisse auf den Begriff. In früheren Zeiten, als unsere Ahnen noch das zum Leben Notwendige zusammenjagten und -sammelten, war diese Frage leicht beantwortet, wenn sie sich denn überhaupt stellte: Man musste so lange ‚arbeiten’ bis man satt zu essen hatte. Es wäre vollkommen sinnlos, ja sogar in höchstem Maße existenzgefährdend gewesen, wenn man versucht hätte, ein Mehr zu erwirtschaften durch mehr Arbeit; denn ihr Dasein konnten unsere frühen Vorfahren nur sichern, wenn sie sich ihre Beweglichkeit erhielten, unbehindert von einem Ort zum andern ziehen konnten, um das Lebensnotwendige zu finden. Weder Besitz, noch Vorsorge waren dem Selbsterhalt zuträglich. Tragbarkeit, portability, nicht Besitz und Vorrat, war darum der höchste Wert. Jeder Besitz war beschwerlich. Es wird von Anthropologen glaubhaft versichert, dass die Jäger- und Sammlerinnen-Kulturen in vorkolonialer Zeit, also bevor ihnen ihr traditionelles Wandergebiet streitig gemacht wurde, nicht mehr als zwei bis fünf Stunden täglich für ihre Existenzsicherung aufwenden mussten. Die übrigen Stunden des Tages standen für Palaver, Schlaf und Gelage zur Verfügung. Noch in der bäuerlichen, sesshaften Lebensweise ist die Frage danach, wie viel Arbeit der Mensch braucht, offenkundig verrückt. Arbeit braucht man nicht, die hat man, und das einzige was über sie zu sagen ist, ist, dass sie getan werden muss. Arbeit ist nicht Gegenstand des Begehrens, sondern das Mittel, das dazu taugt, sein Dasein zu fristen. Sie ist ein notwendiges Übel oder einfach nur notwendig, und sie wird vom Winter, vom Feierabend und Festtag unterbrochen. Das Andere der Arbeit ist also die Muße. In der biblischen Tradition ist sie der Fluch Gottes, der über den erkenntnishungrigen Menschen gesprochen wird. Aber sie ist auch ein Segen, denn in ihr waltet ein Gesetz der Mäßigung, das eine Balance erhält zwischen den Kräften, die man verausgaben kann und dem Begehren, das an diesen Kräften seine Grenze findet. Ich komme darauf zurück.
Noch im 19. Jahrhundert konnten intelligente Leute darüber spotten, dass die Zeitgenossen versessen auf Arbeit waren, dass sie einer krankhaften Arbeitssucht verfallen und in eine geistige Verwirrung geraten waren. Als Heilmittel gegen diese Verwirrung empfahl Paul Lafargue, der Schwiegersohn von Karl Marx, den Arbeitswütigen den wohltuenden Müßiggang und stimmte ein Lob der Faulheit an. Bis ins späte zwanzigste Jahrhundert erhält sich diese Einstellung gegenüber der Arbeit. Hannah Ahrendt stellt sie in ihrer „Vita activa“ den anderen beiden Formen des menschlichen Tätigseins gegenüber, dem ‚Herstellen’ nämlich und dem ‚Handeln’. Und im Vergleich zu diesen beiden schöpferischen Formen der Tätigkeit sieht die Arbeit ziemlich armselig aus.
Während aus dem Herstellen eine Welt von dauerhaften Dingen hervorgeht, die den Menschen in seiner ursprünglichen Unbehaustheit zu schützen vermag, ihm Geborgenheit und Heimat bietet; während das Handeln jener Teil des menschlichen Tuns ist, mit dem die Menschen ihr Miteinander und ihr soziales und politisches Leben regeln, dient die Kärrnerarbeit in nicht endendem Wiederholungszwang der Notdurft des Körpers, der nun einmal immer wieder aufs Neue unerhörte Anstrengungen zu seiner Aufrechterhaltung fordert: Nahrung, Kleidung, Wohnung. Arbeit ist weit davon entfernt, den Menschen zu seiner höheren Seinsbestimmung zu adeln. Er ist in animalischer Abhängigkeit an sie gefesselt, um seiner nackten Selbsterhaltung willen. Genuin menschliche Tätigkeiten, die den Menschen vom animal laborans, vom arbeitenden Tier unterscheiden, sind nur das Herstellen und das Handeln. In den 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde, wie ich mich erinnere, über die tägliche Fron mit einem ‚Hoch lebe die Arbeit, so hoch, dass keiner rankommt’, gewitzelt. Und 1978 veröffentlicht Ivan Illich in seinen ‚Fortschrittsmythen’ einen großen Essay über ‚Schöpferische Arbeitslosigkeit’, der trotz vollkommen veränderter Lebenslage nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Und nun hat auf einmal die Frage: „Wie viel Arbeit braucht der Mensch?“, die so tut, als sei die Arbeit ein wahrer Segen und als könne man dem Menschen nichts besseres tun, als ihn mit Arbeit zu beglücken, gar nichts Anstößiges mehr. Sie scheint geradezu den Kern aller menschlichen Begehrlichkeit zu treffen. Und tatsächlich steht der drohende Verlust der Arbeit sehr hoch oben auf der Rangliste der Befürchtungen, von denen Menschen heimgesucht werden. Weder der Klimawandel, noch Kriegsgefahr können da mithalten, allenfalls unmittelbare gesundheitliche Gefährdung.
Was ist geschehen, dass die Arbeit von einem notwendigen Übel zu einem hochrangigen Lebensziel, dem alle in scharfer Konkurrenz nachjagen, mutieren konnte? Die Antwort ist bestürzend einfach: Es geht in der Frage gar nicht um Arbeit und Arbeit ist auch nicht erstrebenswert. Es geht um Geld. Die Frage: „Wie viel Arbeit braucht der Mensch?“ und jene andere: „Wie viel Geld braucht der Mensch?“ sind gleichbedeutend. Arbeit haben, heißt Geld haben. (Mehr oder weniger, versteht sich, aber das lassen wir jetzt einmal beiseite.) Mit der Gleichsetzung von Arbeit und Geld erfährt die Arbeit eine unerhörte Entwertung, obwohl sie scheinbar so begehrenswert ist wie nie zuvor in der Geschichte. Von den unendlich vielen Weisen, sein Dasein zu sichern durch verschiedenste, an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepasste Unterhaltstätigkeiten und von den verschiedensten Weisen, das gesellschaftliche Miteinander zu gestalten, ist nur die Arbeit für Geld übrig geblieben. Überhaupt sind die Menschen in der industriellen Gesellschaft auf drei Tätigkeitsformen festgelegt, die alle drei verheerende Folgen haben für die Menschen, die radikal entfähigt werden, und für ihre Lebensgrundlagen, die radikal geplündert werden.
Tagsüber sind diejenigen, die Jobs haben, Produzenten von Waren und Dienstleistungen in hochspezialisierten Arbeitsprozessen, in denen sie weder Sinn noch Bedeutung finden können, deren letzter und einziger Sinn darin besteht, dass man dafür Geld bekommt, denn die Verfügung über Geld ist nun einmal die einzige Weise, sich am Leben zu erhalten in einer Gesellschaft, in der alles bewirtschaftet und alles zur Ware geworden ist. Hauptresultat aller modernen, industriellen Gesellschaften ist die „Abwertung der individuell-persönlichen Fähigkeit, etwas zu tun oder zu schaffen, die der Preis jedes zusätzlichen Quantums an Warenüberfluß ist“, schreibt Ivan Illich. Also je mehr Substitute für eigenes Tun industriell erzeugt werden, desto hilfloser und abhängiger werden die Menschen, während sie jedoch glauben durch die Ersparnis von Mühsal immer unabhängiger und freier zu werden. Abends, nach der Arbeit sind die Produzenten Konsumenten, und noch wenn sie schlafen, konsumieren sie, garagiert neben ihren abgestellten Autos, gleichsam auf Transitstation ihre Unterbringung und produzieren an sich selbst so viel Erholung, dass sie anderntags wieder produzieren und konsumieren können. Die Konsumzeit wird gewöhnlich für arbeitsfreie Zeit, für Freizeit erachtet, aber tatsächlich ist das Konsumieren einerseits selbst eine herbe Untertanenpflicht, der sich niemand ungestraft entziehen kann.
Und andererseits müssen wir, um überhaupt konsumieren zu können, immer mehr Schattenarbeit verrichten, jene unbezahlte Arbeit, die notwendig ist, um uns die Marktofferten zugänglich zu machen, um unzulängliche, wertdefiziente Waren oder Dienstleistungen so aufzubessern, dass wir sie brauchen oder verbrauchen können. Ivan Illich, der diese Art von Arbeit präzise analysiert und identifiziert hat, schreibt: „Schattenarbeit wird geleistet von dem Konsumenten, insbesondere im konsumierenden Haushalt. Als Schattenarbeit bezeichne ich all jene Tätigkeiten, durch die der Verbraucher gekaufte Waren in ein nutzbares Gut umwandelt. Schattenarbeit umfasst die Zeit und Mühe, die wir aufwenden müssen, um der gekauften Ware jenen Wert hinzuzufügen, ohne den sie für den Gebrauch untauglich wäre.“1 Schattenarbeit wird insbesondere im Dienstleistungssektor geleistet. Schularbeitenhilfe für die Kinder, Transport der Kinder zu den zahlreichen nachmittäglichen Förderungsmaßnahmen, die Heimwerkerei des Ikea-Kunden, das Warten im Sprechzimmer des Arztes, der Gang zur Berufsberatung, die therapeutischen Maßnahmen, die notwendig werden, damit Kinder und Erwachsene ihren institutionellen Alltag überhaupt überstehen können, die Wartung des Autos, die Bedienung des häuslichen Maschinenparks, die Mülltrennung, das Pendeln zum Arbeitsplatz, das Warten vor der roten Ampel usw., usw. All dies sind Tätigkeiten, die nicht mir selbst oder dem Mitmenschen gelten. Sie sind vielmehr ein Dienst an den Institutionen, die den Menschen die Zuständigkeit für ihre eigenen Angelegenheiten überhaupt erst entzogen haben.
Durch Schattenarbeit richten sich die Konsumenten/Produzenten selbst und gegenseitig für ihre Institutionen- und Maschinentauglichkeit zu. Schattenarbeit macht immer mehr Teilprozesse von Dienstleistungen, die wir ja bezahlen müssen, zur unbezahlten Obliegenheit der Konsumenten. Inzwischen müssen wir den Banken die Arbeit durch Tele-Banking erleichtern, der Bahn AG durch die Selbstbedienung im Internet, der Telekommunikation ihren Konkurrenzkampf durch penible Preisvergleiche ermöglichen. Immer mehr Zeit muss in diese Handlangerei für den Apparatus investiert werden, Zeit, die den Wohltaten, die wir einander gewähren könnten, abgeht. Das also ist die heilige Dreifaltigkeit moderner Arbeit: Produktion, Konsumtion und Schattenarbeit.
Die Frage, wie viel Arbeit der Mensch brauche, könnte unter diesen Umständen zum Stoßseufzer, zur Frage danach werden, wie er der Knechtung durch Produktion, die ihn bis zur Lebensuntüchtigkeit spezialisiert, durch Konsumtion, die ihn gierig und vollständig abhängig, ja erpressbar macht, und durch Schattenarbeit, zu der er in einem Akt der Geiselnahme gezwungen wird, entgehen könne. Sie könnte uns daran erinnern, dass Arbeit keineswegs erstrebenswert ist, jedenfalls nicht die Arbeit, die wir für Geld tun müssen. In ihr könnte sich der Wunsch nicht nach einem Mehr an Arbeit, sondern nach einem Weniger an Arbeit ausdrücken. Moderne Arbeit, auf die alle so scharf sind, dass sie zum obersten Bedürfnis avanciert ist, hat schwerwiegende Folgen für den arbeitenden Menschen, die sich gegenseitig bedingen und aufheizen. Sie macht Zeit knapp, sie macht Menschen hilflos und bedürftig, sie macht Begehren maßlos, und sie bedroht den sozialen Frieden durch rücksichtslose Konkurrenz aller mit allen um die knappen Ressourcen. Die Zeit wird knapp, denn sie wird in der Dreifaltigkeit unserer Pflichten buchstäblich aufgerieben. Andererseits aber gehen wir mit der immer knapper werdenden Zeit immer verschwenderischer um: Die Zeit, die wir in sinn- und bedeutungslosen Arbeitsvollzügen zubringen, geben wir als Lebenszeit schon ohnehin verloren. Das sind also mindestens acht Stunden täglich, die wir schon abgeschrieben haben und die wir nolens volens als den Preis erachten, den wir nun einmal für die Segnungen der Freizeit zu entrichten haben. Arbeitszeit fällt als Zeit sinnerfüllten Lebens aus, wie sehr wir auch bemüht sein mögen, sie uns als sinnvoll verbrachte Zeit schmackhaft zu machen. Wir tendieren ja dazu, Arbeiten zu unterscheiden je nachdem, wie viel Befriedigung sie uns zu geben vermögen. Ist die Arbeitszeit des Chirurgen, des Hochschullehrers, des Politikers, des Landwirts oder Programmierers nicht unendlich viel sinnerfüllter als die Arbeitszeit des Fließbandarbeiters, der Putzfrau oder des Müllwerkers. Interessanterweise werden die Arbeiten, die als sinnstiftend und befriedigend eingeschätzt werden, in unserer Gesellschaft ja entschieden besser entlohnt, als die niederen Arbeiten, die keiner machen will, während es doch gerade umgekehrt sein müsste. Aber die sinnvolle Arbeit müsste sich nicht nur an dem persönlichen Wohlbefinden desjenigen, der sie verrichtet bewähren, sondern daran, dass sie gute Arbeit ist, das heißt solche, die nützt und nicht schadet. Meine zugegebenermaßen anstößige These ist nun die, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es so gut wie keine gute, berufsmäßige, also für Geld verrichtete, Arbeit gibt; dass also alle Arbeit, die der industriellen Erzeugung von Waren und Dienstleistungen gewidmet ist, mehr schadet als nützt. Wer könnte heute noch sagen, dass er oder sie gute Arbeit verrichtet. Alles was wir Heutigen berufsmäßig tun, ist ruinös: Die Landwirtschaft zerstört den Boden, den sie beackert, verseucht und vergiftet ihn oder bringt ihn ganz zum Verschwinden. Die technischen Errungenschaften zerstören unsere Lebensgrundlagen oder reparieren allenfalls, was sie gerade zerstört haben, um umso unbedenklicher weitere Zerstörung anzurichten. Medizin macht krank; Schulbildung verdummt und macht die sogenannten ‚Gebildeten’ unsozial und die andern zu drop outs; Rat und Hilfe führen geradewegs in immer perfektere Verwaltung; die Spitzenkräfte der Wissenschaft stellen ihr Know-how der Vernichtungsindustrie zur Verfügung (mehr als 40 Prozent der hervorragend ausgebildeten Wissenschaftler stehen in irgend einer Form im Dienst der Rüstungsindustrie). Ich bin sicher, dass Sie mir diese These als steil und haltlos ankreiden werden, aber es ist sicher der Mühe wert, sie minutiös zu untersuchen. Wenn ich recht habe mit meiner These, dann ist Arbeitszeit verlorene Zeit, selbst wenn sich die Arbeitenden fidel und vergnügt damit arrangieren und allen Ehrgeiz daran setzen, schlechte Arbeit noch besser zu machen.
Moderne Arbeit macht die Menschen – zweitens – hilflos und bedürftig. In dem Maße, in dem wir, versorgt mit Waren und Dienstleistungen aller Art, uns nur noch darum kümmern müssen, dass wir gute Geldverdiener sind, spezialisieren wir uns auf die Tätigkeit, die Geld heckt, und vernachlässigen alle anderen Fähigkeiten, die uns zu mehr Daseinsmächtigkeit verhelfen könnten. Wir werden kriegende Menschen, das heißt solche, die das, was sie zum Leben brauchen, kaufen, also kriegen müssen. Die Industriegesellschaft ist ihrer eigenen Dynamik nach darauf angelegt, ihre Mitglieder lückenlos mit allem zu versorgen und die Menschen der Selbstsorge und der Zuständigkeit für ihre eigenen Angelegenheiten völlig zu entheben. Es ist gelungen, die Menschen glauben zu machen, dass dies ein großer Gewinn an Freiheit sei, während es doch ein enormer Zuwachs an Abhängigkeit von den ‚Segnungen’ der Versorgungskultur ist, die die Menschen der Verfügungsgewalt über ihre eigenen Belange vollständig beraubt. Ich muss mich nur in meiner eigenen Lebensgeschichte umsehen, um mich darüber zu entsetzen, wie viele von den Lebens- und Sterbensverrichtungen, die in meiner Kindheit noch ganz selbstverständlich in der Verfügung von jedermann und jederfrau waren, von der Reparatur der Dinge des täglichen Bedarfs über die Kurierung von Kinderkrankheiten bis zum Sterbebeistand. Sie fallen heute in die Zuständigkeit von Experten, die sie als Dienstleistungsware feilbieten und jeden Versuch, davon keinen Gebrauch zu machen, nicht nur mit professioneller Strenge entmutigen, sondern sogar scharf sanktionieren.
Bedürftige Menschen sind – drittens – unersättlich. Denn der Zusammenhang zwischen dem, was wir kaufen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, und dem, was wir brauchen, geht vollständig verloren: Unsere Versorgung steht immer unter dem Vorbehalt des Ungenügens. Sie macht die Versorgungsansprüche unersättlich und verlangt angesichts der Bedrängnis meines prekären Lebens immer ‚Mehr-vom- gleichen-Versorgungsmuster’:mehr Lebensjahre, mehr Gesundheitsmaßnahmen, mehr Leidvermeidung, mehr Zerstreuung und Ablenkung, mehr Supermarkt, mehr Sicherheitsgarantien und mehr Geld, das vor allem. Wir haben uns um unserer Versorgtheit willen unser Tun stehlen lassen, und das ist verhängnisvoll.
Im eigenverantwortlichen Tun waltet ein inneres Gesetz der Mäßigung: Es kostet Zeit und Kräfte. Beides steht uns Menschen nur in einem begrenzten Umfang zur Verfügung. Die Verführung besteht darin, diese Grenzen zu sprengen. Mit Hilfe der Arbeitsteilung und dem Einsatz von ‚Energiesklaven’ (H.P.Dürr), die uns von unserem Tun entfremden und uns zu Geldverdienern machen, hat unsere Befehlsgewalt eine überwältigende Steigerung erfahren. Mit einem einzigen Knopfdruck, einem einzigen Schalterkippen, einer minimalen Handhabung können wir ganze Kolonnen von Arbeitskräften in Dienst stellen, die wir nie kennenlernen werden, denen wir nicht einen einzigen Befehl zurufen. Ich drehe den Wasserhahn auf und beschäftige eine unübersehbare Fülle von dienstbaren Mensch-Maschine Komplexen, von denen ich nicht einmal weiß, dass es sie gibt. Ich schalte Licht an, und lasse die Puppen tanzen, ohne mir Rechenschaft über ihre Existenz geben zu müssen. Das einzige, das mich mit diesen dienstbaren Gespenstern verbindet, ist eine gewisse Summe Geldes, die ich irgendwo hinterlege und deren Beförderung an die zuständige Empfangsstelle wiederum Hunderte von Dienstleistern mobilisiert. Ich kaufe ein paar Zwiebeln, die mich – so will es das Gesetz – über ihre Herkunft informieren müssen, und ich lese, dass sie weit gereist sind. Sie kommen aus Argentinien. An der Kasse zahle ich ein paar Cent. Und mit diesem Scherflein habe ich Piloten, Kopiloten, Flugüberwachung, Beladungspersonal, Flugzeugbauer und -konstrukteure, die Ölindustrie mit ihrer gesamten Entourage, Agrobusiness, Speditionsfirmen für den Landtransport, die Lastwagenfahrer und die Lastwagenbauer, die Personage der WTO, die die mörderischen Handelsabkommen austüftelt und zu guter Letzt auch die miserabel entlohnten argentinischen Bauersfrauen und Tagelöhner zu meinen ‚Söldnern’ gemacht. Vollkommen aussichtslos, eine auch nur annähernd komplette Liste derjenigen zu erstellen, die daran beteiligt sind, dass mein Pfund Zwiebeln auf meinem Küchentisch landet. Denn auch ich bin ja mit meinem Auto auf Straßen, die gewartet und überwacht werden, in den Supermarkt gefahren, dessen Personal meinen Einkauf und meinen Zahlungsverkehr ermöglicht. Ich habe mein Geld von der Bank geholt, hinter der ebenfalls ein gewaltiger Apparat steht und so weiter und so weiter. Und wie lächerlich geringfügig ist mein Einsatz für diese allgemeine Mobilmachung von Mensch und Maschine: Die paar Cent, die ich in Bruchteilen einer Stunde mit meiner Arbeit ‚verdient’ habe, genügen als Gegenleistung für diese ungeheure Mobilisierung von Kräften. Ein überwältigendes Missverhältnis gibt sich, wenn auch nur schemenhaft zu erkennen, und lässt mich ahnen, dass zwischen meinem Versorgtsein und meinem Tun keinerlei Verbindung mehr besteht, weder in der Erfahrbarkeit, noch in der Größenordnung, deren Dimensionen gigantisch sind. Kein Wunder, dass mich das um den Verstand bringt, will sagen, um das Gespür für Angemessenheit und um das Gefühl dafür, wann etwas genug ist. Stellen wir uns nur einen Augenblick lang jene anderen Zwiebeln vor, die ihrer Art nach völlig unvergleichlich mit den argentinischen sind. Ich meine jene Zwiebeln, die in meinem Garten gedeihen, auf dem Boden, den ich bearbeitet habe, mit dem Kompost, den ich übers Jahr gesammelt habe, gedüngt, deren Gedeihen ich beobachtet und deren Erntereife ich geduldig erwartet habe und die dann vom Garten in die Küche getragen werden und eine Mahlzeit bereichern. An diesen Zwiebeln kann ich meine Ansprüche ausrichten, denn ich weiß um die Mühe und den Aufwand an Zeit, und um die nicht in meiner Verfügung stehenden Kräfte ihres Wachsens, den Regen und die Sonne, und alles was im Boden kriecht und wirkt. Oder: Stellen wir uns das Wasser vor, das die afrikanischen Mädchen morgens bei Sonnenaufgang von der nahen oder weiter entfernten Wasserstelle herbeigetragen haben im Vergleich zu jenem, dass aus unseren Wasserhähnen läuft. Wie einfach ist es für diese Mädchen zu ermessen, was genug sein bedeutet, denn sie wissen um die Anstrengung, derer es bedarf, um mehr zu haben. Solange all unsere Anstrengung dem Gelderwerb gilt, haben wir unserer Urteilskraft in der Frage, was wir brauchen, eingebüßt. Vom Geld kann man halt nie genug haben.
Konsumenten sind – viertens – ‚kriegende’ Menschen, so haben wir festgestellt. Kriegende Menschen sind aber nicht nur solche, die alles, was sie zu brauchen glauben, kriegen müssen, sondern auch solche, die mit allen anderen im latenten Kriegszustand leben. Denn alle anderen sind genau so darauf angewiesen von den knappen Vorräten genug abzukriegen. Jeder Vorteil des einen ist nur zu haben um den Nachteil des anderen. Und so ist das Prinzip der Verfeindung die Grundlage der konsumistischen Gesellschaft. Die Frage: ‚Wie viel Arbeit braucht der Mensch?’ ist also einerseits getrieben von der Sorge, mir meinen Vorteil auf dem Markt der knappen Ware ‚Arbeit’ zu sichern und andererseits von dem Überdruss an einem Tätigsein gezeichnet, das mich als Person leer ausgehen lässt, wie viel Geld auch dabei herausspringt. Und noch eine Bemerkung zum Schluss: Wenn ich mit der These recht habe, dass wir heute in jedweder beruflichen Tätigkeit mehr Schaden anrichten als nützen, dann können wir getrost unser Verhältnis zu den Arbeitslosen, die wir gern als Gescheiterte ansehen, überdenken. Nicht sie, sondern die im Arbeitsleben Stehenden hätten sich dann die Sinnfrage zu stellen und stünden in einer vollkommenen Umkehrung der Beweislast unter Rechtfertigungszwang.
1 Ivan Illich: Genuss. Zur einer historischen Kritik der Gleichheit. München 1995, S. 31.
Der vorliegende Text wurde 2008 als Vortrag auf einer Veranstaltung der Grünen in Linz gehalten.
Noch im 19. Jahrhundert konnten intelligente Leute darüber spotten, dass die Zeitgenossen versessen auf Arbeit waren, dass sie einer krankhaften Arbeitssucht verfallen und in eine geistige Verwirrung geraten waren. Als Heilmittel gegen diese Verwirrung empfahl Paul Lafargue, der Schwiegersohn von Karl Marx, den Arbeitswütigen den wohltuenden Müßiggang und stimmte ein Lob der Faulheit an. Bis ins späte zwanzigste Jahrhundert erhält sich diese Einstellung gegenüber der Arbeit. Hannah Ahrendt stellt sie in ihrer „Vita activa“ den anderen beiden Formen des menschlichen Tätigseins gegenüber, dem ‚Herstellen’ nämlich und dem ‚Handeln’. Und im Vergleich zu diesen beiden schöpferischen Formen der Tätigkeit sieht die Arbeit ziemlich armselig aus.
Während aus dem Herstellen eine Welt von dauerhaften Dingen hervorgeht, die den Menschen in seiner ursprünglichen Unbehaustheit zu schützen vermag, ihm Geborgenheit und Heimat bietet; während das Handeln jener Teil des menschlichen Tuns ist, mit dem die Menschen ihr Miteinander und ihr soziales und politisches Leben regeln, dient die Kärrnerarbeit in nicht endendem Wiederholungszwang der Notdurft des Körpers, der nun einmal immer wieder aufs Neue unerhörte Anstrengungen zu seiner Aufrechterhaltung fordert: Nahrung, Kleidung, Wohnung. Arbeit ist weit davon entfernt, den Menschen zu seiner höheren Seinsbestimmung zu adeln. Er ist in animalischer Abhängigkeit an sie gefesselt, um seiner nackten Selbsterhaltung willen. Genuin menschliche Tätigkeiten, die den Menschen vom animal laborans, vom arbeitenden Tier unterscheiden, sind nur das Herstellen und das Handeln. In den 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde, wie ich mich erinnere, über die tägliche Fron mit einem ‚Hoch lebe die Arbeit, so hoch, dass keiner rankommt’, gewitzelt. Und 1978 veröffentlicht Ivan Illich in seinen ‚Fortschrittsmythen’ einen großen Essay über ‚Schöpferische Arbeitslosigkeit’, der trotz vollkommen veränderter Lebenslage nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Und nun hat auf einmal die Frage: „Wie viel Arbeit braucht der Mensch?“, die so tut, als sei die Arbeit ein wahrer Segen und als könne man dem Menschen nichts besseres tun, als ihn mit Arbeit zu beglücken, gar nichts Anstößiges mehr. Sie scheint geradezu den Kern aller menschlichen Begehrlichkeit zu treffen. Und tatsächlich steht der drohende Verlust der Arbeit sehr hoch oben auf der Rangliste der Befürchtungen, von denen Menschen heimgesucht werden. Weder der Klimawandel, noch Kriegsgefahr können da mithalten, allenfalls unmittelbare gesundheitliche Gefährdung.
Was ist geschehen, dass die Arbeit von einem notwendigen Übel zu einem hochrangigen Lebensziel, dem alle in scharfer Konkurrenz nachjagen, mutieren konnte? Die Antwort ist bestürzend einfach: Es geht in der Frage gar nicht um Arbeit und Arbeit ist auch nicht erstrebenswert. Es geht um Geld. Die Frage: „Wie viel Arbeit braucht der Mensch?“ und jene andere: „Wie viel Geld braucht der Mensch?“ sind gleichbedeutend. Arbeit haben, heißt Geld haben. (Mehr oder weniger, versteht sich, aber das lassen wir jetzt einmal beiseite.) Mit der Gleichsetzung von Arbeit und Geld erfährt die Arbeit eine unerhörte Entwertung, obwohl sie scheinbar so begehrenswert ist wie nie zuvor in der Geschichte. Von den unendlich vielen Weisen, sein Dasein zu sichern durch verschiedenste, an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten angepasste Unterhaltstätigkeiten und von den verschiedensten Weisen, das gesellschaftliche Miteinander zu gestalten, ist nur die Arbeit für Geld übrig geblieben. Überhaupt sind die Menschen in der industriellen Gesellschaft auf drei Tätigkeitsformen festgelegt, die alle drei verheerende Folgen haben für die Menschen, die radikal entfähigt werden, und für ihre Lebensgrundlagen, die radikal geplündert werden.
Tagsüber sind diejenigen, die Jobs haben, Produzenten von Waren und Dienstleistungen in hochspezialisierten Arbeitsprozessen, in denen sie weder Sinn noch Bedeutung finden können, deren letzter und einziger Sinn darin besteht, dass man dafür Geld bekommt, denn die Verfügung über Geld ist nun einmal die einzige Weise, sich am Leben zu erhalten in einer Gesellschaft, in der alles bewirtschaftet und alles zur Ware geworden ist. Hauptresultat aller modernen, industriellen Gesellschaften ist die „Abwertung der individuell-persönlichen Fähigkeit, etwas zu tun oder zu schaffen, die der Preis jedes zusätzlichen Quantums an Warenüberfluß ist“, schreibt Ivan Illich. Also je mehr Substitute für eigenes Tun industriell erzeugt werden, desto hilfloser und abhängiger werden die Menschen, während sie jedoch glauben durch die Ersparnis von Mühsal immer unabhängiger und freier zu werden. Abends, nach der Arbeit sind die Produzenten Konsumenten, und noch wenn sie schlafen, konsumieren sie, garagiert neben ihren abgestellten Autos, gleichsam auf Transitstation ihre Unterbringung und produzieren an sich selbst so viel Erholung, dass sie anderntags wieder produzieren und konsumieren können. Die Konsumzeit wird gewöhnlich für arbeitsfreie Zeit, für Freizeit erachtet, aber tatsächlich ist das Konsumieren einerseits selbst eine herbe Untertanenpflicht, der sich niemand ungestraft entziehen kann.
Und andererseits müssen wir, um überhaupt konsumieren zu können, immer mehr Schattenarbeit verrichten, jene unbezahlte Arbeit, die notwendig ist, um uns die Marktofferten zugänglich zu machen, um unzulängliche, wertdefiziente Waren oder Dienstleistungen so aufzubessern, dass wir sie brauchen oder verbrauchen können. Ivan Illich, der diese Art von Arbeit präzise analysiert und identifiziert hat, schreibt: „Schattenarbeit wird geleistet von dem Konsumenten, insbesondere im konsumierenden Haushalt. Als Schattenarbeit bezeichne ich all jene Tätigkeiten, durch die der Verbraucher gekaufte Waren in ein nutzbares Gut umwandelt. Schattenarbeit umfasst die Zeit und Mühe, die wir aufwenden müssen, um der gekauften Ware jenen Wert hinzuzufügen, ohne den sie für den Gebrauch untauglich wäre.“1 Schattenarbeit wird insbesondere im Dienstleistungssektor geleistet. Schularbeitenhilfe für die Kinder, Transport der Kinder zu den zahlreichen nachmittäglichen Förderungsmaßnahmen, die Heimwerkerei des Ikea-Kunden, das Warten im Sprechzimmer des Arztes, der Gang zur Berufsberatung, die therapeutischen Maßnahmen, die notwendig werden, damit Kinder und Erwachsene ihren institutionellen Alltag überhaupt überstehen können, die Wartung des Autos, die Bedienung des häuslichen Maschinenparks, die Mülltrennung, das Pendeln zum Arbeitsplatz, das Warten vor der roten Ampel usw., usw. All dies sind Tätigkeiten, die nicht mir selbst oder dem Mitmenschen gelten. Sie sind vielmehr ein Dienst an den Institutionen, die den Menschen die Zuständigkeit für ihre eigenen Angelegenheiten überhaupt erst entzogen haben.
Durch Schattenarbeit richten sich die Konsumenten/Produzenten selbst und gegenseitig für ihre Institutionen- und Maschinentauglichkeit zu. Schattenarbeit macht immer mehr Teilprozesse von Dienstleistungen, die wir ja bezahlen müssen, zur unbezahlten Obliegenheit der Konsumenten. Inzwischen müssen wir den Banken die Arbeit durch Tele-Banking erleichtern, der Bahn AG durch die Selbstbedienung im Internet, der Telekommunikation ihren Konkurrenzkampf durch penible Preisvergleiche ermöglichen. Immer mehr Zeit muss in diese Handlangerei für den Apparatus investiert werden, Zeit, die den Wohltaten, die wir einander gewähren könnten, abgeht. Das also ist die heilige Dreifaltigkeit moderner Arbeit: Produktion, Konsumtion und Schattenarbeit.
Die Frage, wie viel Arbeit der Mensch brauche, könnte unter diesen Umständen zum Stoßseufzer, zur Frage danach werden, wie er der Knechtung durch Produktion, die ihn bis zur Lebensuntüchtigkeit spezialisiert, durch Konsumtion, die ihn gierig und vollständig abhängig, ja erpressbar macht, und durch Schattenarbeit, zu der er in einem Akt der Geiselnahme gezwungen wird, entgehen könne. Sie könnte uns daran erinnern, dass Arbeit keineswegs erstrebenswert ist, jedenfalls nicht die Arbeit, die wir für Geld tun müssen. In ihr könnte sich der Wunsch nicht nach einem Mehr an Arbeit, sondern nach einem Weniger an Arbeit ausdrücken. Moderne Arbeit, auf die alle so scharf sind, dass sie zum obersten Bedürfnis avanciert ist, hat schwerwiegende Folgen für den arbeitenden Menschen, die sich gegenseitig bedingen und aufheizen. Sie macht Zeit knapp, sie macht Menschen hilflos und bedürftig, sie macht Begehren maßlos, und sie bedroht den sozialen Frieden durch rücksichtslose Konkurrenz aller mit allen um die knappen Ressourcen. Die Zeit wird knapp, denn sie wird in der Dreifaltigkeit unserer Pflichten buchstäblich aufgerieben. Andererseits aber gehen wir mit der immer knapper werdenden Zeit immer verschwenderischer um: Die Zeit, die wir in sinn- und bedeutungslosen Arbeitsvollzügen zubringen, geben wir als Lebenszeit schon ohnehin verloren. Das sind also mindestens acht Stunden täglich, die wir schon abgeschrieben haben und die wir nolens volens als den Preis erachten, den wir nun einmal für die Segnungen der Freizeit zu entrichten haben. Arbeitszeit fällt als Zeit sinnerfüllten Lebens aus, wie sehr wir auch bemüht sein mögen, sie uns als sinnvoll verbrachte Zeit schmackhaft zu machen. Wir tendieren ja dazu, Arbeiten zu unterscheiden je nachdem, wie viel Befriedigung sie uns zu geben vermögen. Ist die Arbeitszeit des Chirurgen, des Hochschullehrers, des Politikers, des Landwirts oder Programmierers nicht unendlich viel sinnerfüllter als die Arbeitszeit des Fließbandarbeiters, der Putzfrau oder des Müllwerkers. Interessanterweise werden die Arbeiten, die als sinnstiftend und befriedigend eingeschätzt werden, in unserer Gesellschaft ja entschieden besser entlohnt, als die niederen Arbeiten, die keiner machen will, während es doch gerade umgekehrt sein müsste. Aber die sinnvolle Arbeit müsste sich nicht nur an dem persönlichen Wohlbefinden desjenigen, der sie verrichtet bewähren, sondern daran, dass sie gute Arbeit ist, das heißt solche, die nützt und nicht schadet. Meine zugegebenermaßen anstößige These ist nun die, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es so gut wie keine gute, berufsmäßige, also für Geld verrichtete, Arbeit gibt; dass also alle Arbeit, die der industriellen Erzeugung von Waren und Dienstleistungen gewidmet ist, mehr schadet als nützt. Wer könnte heute noch sagen, dass er oder sie gute Arbeit verrichtet. Alles was wir Heutigen berufsmäßig tun, ist ruinös: Die Landwirtschaft zerstört den Boden, den sie beackert, verseucht und vergiftet ihn oder bringt ihn ganz zum Verschwinden. Die technischen Errungenschaften zerstören unsere Lebensgrundlagen oder reparieren allenfalls, was sie gerade zerstört haben, um umso unbedenklicher weitere Zerstörung anzurichten. Medizin macht krank; Schulbildung verdummt und macht die sogenannten ‚Gebildeten’ unsozial und die andern zu drop outs; Rat und Hilfe führen geradewegs in immer perfektere Verwaltung; die Spitzenkräfte der Wissenschaft stellen ihr Know-how der Vernichtungsindustrie zur Verfügung (mehr als 40 Prozent der hervorragend ausgebildeten Wissenschaftler stehen in irgend einer Form im Dienst der Rüstungsindustrie). Ich bin sicher, dass Sie mir diese These als steil und haltlos ankreiden werden, aber es ist sicher der Mühe wert, sie minutiös zu untersuchen. Wenn ich recht habe mit meiner These, dann ist Arbeitszeit verlorene Zeit, selbst wenn sich die Arbeitenden fidel und vergnügt damit arrangieren und allen Ehrgeiz daran setzen, schlechte Arbeit noch besser zu machen.
Moderne Arbeit macht die Menschen – zweitens – hilflos und bedürftig. In dem Maße, in dem wir, versorgt mit Waren und Dienstleistungen aller Art, uns nur noch darum kümmern müssen, dass wir gute Geldverdiener sind, spezialisieren wir uns auf die Tätigkeit, die Geld heckt, und vernachlässigen alle anderen Fähigkeiten, die uns zu mehr Daseinsmächtigkeit verhelfen könnten. Wir werden kriegende Menschen, das heißt solche, die das, was sie zum Leben brauchen, kaufen, also kriegen müssen. Die Industriegesellschaft ist ihrer eigenen Dynamik nach darauf angelegt, ihre Mitglieder lückenlos mit allem zu versorgen und die Menschen der Selbstsorge und der Zuständigkeit für ihre eigenen Angelegenheiten völlig zu entheben. Es ist gelungen, die Menschen glauben zu machen, dass dies ein großer Gewinn an Freiheit sei, während es doch ein enormer Zuwachs an Abhängigkeit von den ‚Segnungen’ der Versorgungskultur ist, die die Menschen der Verfügungsgewalt über ihre eigenen Belange vollständig beraubt. Ich muss mich nur in meiner eigenen Lebensgeschichte umsehen, um mich darüber zu entsetzen, wie viele von den Lebens- und Sterbensverrichtungen, die in meiner Kindheit noch ganz selbstverständlich in der Verfügung von jedermann und jederfrau waren, von der Reparatur der Dinge des täglichen Bedarfs über die Kurierung von Kinderkrankheiten bis zum Sterbebeistand. Sie fallen heute in die Zuständigkeit von Experten, die sie als Dienstleistungsware feilbieten und jeden Versuch, davon keinen Gebrauch zu machen, nicht nur mit professioneller Strenge entmutigen, sondern sogar scharf sanktionieren.
Bedürftige Menschen sind – drittens – unersättlich. Denn der Zusammenhang zwischen dem, was wir kaufen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, und dem, was wir brauchen, geht vollständig verloren: Unsere Versorgung steht immer unter dem Vorbehalt des Ungenügens. Sie macht die Versorgungsansprüche unersättlich und verlangt angesichts der Bedrängnis meines prekären Lebens immer ‚Mehr-vom- gleichen-Versorgungsmuster’:mehr Lebensjahre, mehr Gesundheitsmaßnahmen, mehr Leidvermeidung, mehr Zerstreuung und Ablenkung, mehr Supermarkt, mehr Sicherheitsgarantien und mehr Geld, das vor allem. Wir haben uns um unserer Versorgtheit willen unser Tun stehlen lassen, und das ist verhängnisvoll.
Im eigenverantwortlichen Tun waltet ein inneres Gesetz der Mäßigung: Es kostet Zeit und Kräfte. Beides steht uns Menschen nur in einem begrenzten Umfang zur Verfügung. Die Verführung besteht darin, diese Grenzen zu sprengen. Mit Hilfe der Arbeitsteilung und dem Einsatz von ‚Energiesklaven’ (H.P.Dürr), die uns von unserem Tun entfremden und uns zu Geldverdienern machen, hat unsere Befehlsgewalt eine überwältigende Steigerung erfahren. Mit einem einzigen Knopfdruck, einem einzigen Schalterkippen, einer minimalen Handhabung können wir ganze Kolonnen von Arbeitskräften in Dienst stellen, die wir nie kennenlernen werden, denen wir nicht einen einzigen Befehl zurufen. Ich drehe den Wasserhahn auf und beschäftige eine unübersehbare Fülle von dienstbaren Mensch-Maschine Komplexen, von denen ich nicht einmal weiß, dass es sie gibt. Ich schalte Licht an, und lasse die Puppen tanzen, ohne mir Rechenschaft über ihre Existenz geben zu müssen. Das einzige, das mich mit diesen dienstbaren Gespenstern verbindet, ist eine gewisse Summe Geldes, die ich irgendwo hinterlege und deren Beförderung an die zuständige Empfangsstelle wiederum Hunderte von Dienstleistern mobilisiert. Ich kaufe ein paar Zwiebeln, die mich – so will es das Gesetz – über ihre Herkunft informieren müssen, und ich lese, dass sie weit gereist sind. Sie kommen aus Argentinien. An der Kasse zahle ich ein paar Cent. Und mit diesem Scherflein habe ich Piloten, Kopiloten, Flugüberwachung, Beladungspersonal, Flugzeugbauer und -konstrukteure, die Ölindustrie mit ihrer gesamten Entourage, Agrobusiness, Speditionsfirmen für den Landtransport, die Lastwagenfahrer und die Lastwagenbauer, die Personage der WTO, die die mörderischen Handelsabkommen austüftelt und zu guter Letzt auch die miserabel entlohnten argentinischen Bauersfrauen und Tagelöhner zu meinen ‚Söldnern’ gemacht. Vollkommen aussichtslos, eine auch nur annähernd komplette Liste derjenigen zu erstellen, die daran beteiligt sind, dass mein Pfund Zwiebeln auf meinem Küchentisch landet. Denn auch ich bin ja mit meinem Auto auf Straßen, die gewartet und überwacht werden, in den Supermarkt gefahren, dessen Personal meinen Einkauf und meinen Zahlungsverkehr ermöglicht. Ich habe mein Geld von der Bank geholt, hinter der ebenfalls ein gewaltiger Apparat steht und so weiter und so weiter. Und wie lächerlich geringfügig ist mein Einsatz für diese allgemeine Mobilmachung von Mensch und Maschine: Die paar Cent, die ich in Bruchteilen einer Stunde mit meiner Arbeit ‚verdient’ habe, genügen als Gegenleistung für diese ungeheure Mobilisierung von Kräften. Ein überwältigendes Missverhältnis gibt sich, wenn auch nur schemenhaft zu erkennen, und lässt mich ahnen, dass zwischen meinem Versorgtsein und meinem Tun keinerlei Verbindung mehr besteht, weder in der Erfahrbarkeit, noch in der Größenordnung, deren Dimensionen gigantisch sind. Kein Wunder, dass mich das um den Verstand bringt, will sagen, um das Gespür für Angemessenheit und um das Gefühl dafür, wann etwas genug ist. Stellen wir uns nur einen Augenblick lang jene anderen Zwiebeln vor, die ihrer Art nach völlig unvergleichlich mit den argentinischen sind. Ich meine jene Zwiebeln, die in meinem Garten gedeihen, auf dem Boden, den ich bearbeitet habe, mit dem Kompost, den ich übers Jahr gesammelt habe, gedüngt, deren Gedeihen ich beobachtet und deren Erntereife ich geduldig erwartet habe und die dann vom Garten in die Küche getragen werden und eine Mahlzeit bereichern. An diesen Zwiebeln kann ich meine Ansprüche ausrichten, denn ich weiß um die Mühe und den Aufwand an Zeit, und um die nicht in meiner Verfügung stehenden Kräfte ihres Wachsens, den Regen und die Sonne, und alles was im Boden kriecht und wirkt. Oder: Stellen wir uns das Wasser vor, das die afrikanischen Mädchen morgens bei Sonnenaufgang von der nahen oder weiter entfernten Wasserstelle herbeigetragen haben im Vergleich zu jenem, dass aus unseren Wasserhähnen läuft. Wie einfach ist es für diese Mädchen zu ermessen, was genug sein bedeutet, denn sie wissen um die Anstrengung, derer es bedarf, um mehr zu haben. Solange all unsere Anstrengung dem Gelderwerb gilt, haben wir unserer Urteilskraft in der Frage, was wir brauchen, eingebüßt. Vom Geld kann man halt nie genug haben.
Konsumenten sind – viertens – ‚kriegende’ Menschen, so haben wir festgestellt. Kriegende Menschen sind aber nicht nur solche, die alles, was sie zu brauchen glauben, kriegen müssen, sondern auch solche, die mit allen anderen im latenten Kriegszustand leben. Denn alle anderen sind genau so darauf angewiesen von den knappen Vorräten genug abzukriegen. Jeder Vorteil des einen ist nur zu haben um den Nachteil des anderen. Und so ist das Prinzip der Verfeindung die Grundlage der konsumistischen Gesellschaft. Die Frage: ‚Wie viel Arbeit braucht der Mensch?’ ist also einerseits getrieben von der Sorge, mir meinen Vorteil auf dem Markt der knappen Ware ‚Arbeit’ zu sichern und andererseits von dem Überdruss an einem Tätigsein gezeichnet, das mich als Person leer ausgehen lässt, wie viel Geld auch dabei herausspringt. Und noch eine Bemerkung zum Schluss: Wenn ich mit der These recht habe, dass wir heute in jedweder beruflichen Tätigkeit mehr Schaden anrichten als nützen, dann können wir getrost unser Verhältnis zu den Arbeitslosen, die wir gern als Gescheiterte ansehen, überdenken. Nicht sie, sondern die im Arbeitsleben Stehenden hätten sich dann die Sinnfrage zu stellen und stünden in einer vollkommenen Umkehrung der Beweislast unter Rechtfertigungszwang.
1 Ivan Illich: Genuss. Zur einer historischen Kritik der Gleichheit. München 1995, S. 31.
Der vorliegende Text wurde 2008 als Vortrag auf einer Veranstaltung der Grünen in Linz gehalten.