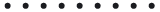Das Abseits als wirtlicher Ort
Dem Konsumismus trotzen!
Wer die moderne Industriegesellschaft analysieren will, muss vom Müll reden. Man kann von nahezu allen Industrieprodukten, die fabriziert werden, sagen, dass ihr eigentlicher Daseinszweck darin besteht, Müll zu sein. Sie werden nicht hergestellt, um brauchbar und zu etwas tauglich zu sein, sondern, um möglichst rasch unbrauchbar und untauglich zu werden.
Wenn der Wert eines beliebigen Gegenstandes darin besteht, brandneu zu sein, der letzte Schrei, die Überbietung alles bisher Dagewesenen, dann ist er in demselben Moment, in dem er auf den Plan tritt, bereits im freien Wertverfall begriffen, denn er ist ja nur die Vorstufe des neueren Neuesten, das ihm folgt, er trägt den Makel des Überholten und Defizienten bereits in sich, bevor er zum Zuge kommen kann. In unseren allergeordnetsten Verhältnissen sind wir Müllbewohner, denn wir wohnen inmitten von Dingen, Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten, die kaum, dass das Licht der Welt sie gesehen hat, schon zum alten Eisen gehören.
Wollte man die moderne industrielle Gesellschaft auf einen Begriff bringen, dann könnte man sie als müllgenerierende Gesellschaft bezeichnen. Das, was wir gedankenlos ›Fortschritt‹ nennen, ist die rasant beschleunigte Umwandlung unserer Welt in Müll, der dann seinerseits das einzig Beständige ist. Was Erich Fromm in den 70er Jahren die ›Orientierung am Haben‹ nannte, bildet die Befindlichkeit des modernen von der Vermüllung gezeichneten Konsumenten nur noch unzureichend ab.
Nicht nur die sachlichen Produkte, sondern auch Dienstleistungen aller Art, auch die ›edlen‹ lehrenden, heilenden und helfenden, tragen in dem Maße, in dem sie gewinnträchtig sein sollen, ihren Teil zur Vermüllung unserer Verhältnisse bei. Auch sie sind nicht dazu ausersehen zu helfen oder Abhilfe zu schaffen, sondern dazu, die allgemeine Hilflosigkeit zu mehren und Versorgungsbedürftigkeit zu schüren.
Die warenförmigen Produkte, die die Industriegesellschaft unter der Maßgabe, dass Wachstum sein müsse, ausspuckt, leiden ausnahmslos an einem eklatanten Mangel an Brauchbarkeit und Haltbarkeit. Nun ist aber gerade Haltbarkeit, die Fähigkeit, zu überdauern und hartnäckig der Zersetzung und der Wiedereingliederung in die Naturkreisläufe zu widerstehen, eine hervorstechende Eigenschaft des Mülls. Es ist gerade seine Zähigkeit und Unvergänglichkeit, die uns zu schaffen macht. Wir müssen also unterscheiden zwischen der Haltbarkeit, die einem Gegenstand als Gebrauchsgut eignet und ihn für eine möglichst lange Dauer gegen Verfall und Unbrauchbarkeit resistent macht, und jener, die ihm als Müll anhaftet. Was an den Dingen des Gebrauchs ein hohes Gut ist, nämlich Haltbarkeit, ist am Müll verhängnisvoll.
Der modernste Müll ist demnach nicht der, der auf Deponien lagert, sondern der, der in den Regalen der Kaufhäuser und in den Werbebroschüren der Dienstleistungsindustrie feilgeboten wird, als Müll unkenntlich und deshalb durchaus Objekt der Begierde: „Abfall ist das finstere, schändliche Geheimnis jeglicher Produktion. Es soll vorzugsweise ein Geheimnis bleiben“, schreibt Zygmunt Bauman. ¹
Selbstverständlich ist der real existierende Müll kein Geheimnis; er macht sich sogar drastisch bemerkbar: er stinkt, ist hässlich, ekelerregend, er stört. Er muss weg.
Und so ist man dann auf das ›ressourcenschonende‹ Verfahren des Recycling verfallen. Aber in Wahrheit dient das Recycling dazu, das „finstere, schändliche Geheimnis der Produktion“ zu hüten. Damit etwas recycelt werden kann, muss es ja zuvor aus einem Zyklus herausgeschleudert worden oder daraus ausgebrochen sein. Es trägt die Spuren der Verwüstung bereits in sich. Mehr noch: Recycling ist seinerseits nur eine Etappe in der Produktion weiteren industriellen Mülls, die denselben Gesetzen folgt wie die Produktion selbst: den Gesetzen der Überproduktion und des zerstörerischen Wachstums, der Ersetzung aller Tätigkeit durch Waren, der Verwandlung der Welt in eine globale Deponie im Kampf gegen Langlebigkeit, Brauchbarkeit und Konvivialität. Recycling ist Vermüllung mit gutem Gewissen, es hat seine Unschuld längst verloren. Ich habe den dunklen Verdacht, dass wir auch dem finsteren Geheimnis der ›Nachhaltigkeit‹ noch lange nicht auf der Spur sind.
Wie lebt es sich in einer müllerzeugenden Gesellschaft? Was wird aus Menschen, deren Arbeit nicht nur zu nichts nütze ist, sondern schweren Schaden anrichtet?
Wie wirkt sich die Tatsache, dass wir uns in einer Welt aus Müll einrichten müssen, auf unser Weltempfinden und unser Befinden aus? Zunächst einmal so, dass wir uns in ihr überhaupt nicht einrichten können. Das, was Hannah Arendt als den Lohn des „Her-stellens“ erkennt, dass nämlich dabei eine Welt aus Dingen entsteht, die dauerhafter sind als wir selbst und in der wir deshalb Halt und Haltung finden können, gilt nicht für die industrielle Produktion. Die erschafft eine Welt, in der das Allerneueste am erstrebenswertesten ist. In ihr kann man sich guten Gewissens für nichts mehr entscheiden, weil jede Entscheidung für etwas mich nötigt, mich mit Defizitärem zu begnügen, und mich um die Möglichkeit bringt, dem demnächst Allerneuesten den Zuschlag zu geben. Selbst die unschuldig geglaubten Ökoprodukte entgehen dem Gesetz der Vermüllung nicht: Ist es nicht voreilig oder unvernünftig, die Sonnenenergieanlage auf mein Dach zu setzen, die heute die am weitesten entwickelte ist, wenn doch morgen die Entwicklung darüber hingegangen sein wird und ich meine finanziellen Ressourcen für etwas hoffnungslos Veraltetes verausgabt habe? Ist es nicht unsinnig, meine Entscheidung auf ein Wissen zu gründen, das morgen überholt sein wird. Ist es nicht verrückt, Zeit und Kraft in eine Bildung zu investieren, die morgen karrierehinderlich ist? Ist es nicht unverantwortlich, heute an etwas zu glauben, das morgen als schierer Aberglaube entlarvt sein wird. Jede ergriffene Chance ist eine Niederlage, jede getroffene Entscheidung ist eine Entscheidung für Müll. Sie verwandelt eine Verheißung in eine Verfehlung und Enttäuschung.
Es gibt immer mehr Dinge, die nicht vergehen können. Müll ist ›unverweslich‹. Aber noch beharrlicher als der Müll selbst ist die Monokultur der Müllgesinnung. Monokulturen und Monopole bedingen sich gegenseitig. Es sind mächtige Monopole, die dafür Sorge tragen, dass das schändliche Geheimnis der Wachstumsgesellschaft – dass sie nämlich Müll produziert und konsumiert – nicht ruchbar wird und dass das „Weiter-So“ seinen ungehinderten Lauf nimmt. Es sind jene treibenden Kräfte, die den Fortschritt garantieren: die Naturwissenschaft, die Ökonomie, die Technik und die Bürokratie.
In seinem Geltungsanspruch ist dieses Quartett so gebieterisch wie einst die apokalyptischen Reiter, die allerdings ganz andere Namen trugen und die mittelalterlichen Menschen in Angst und Schrecken versetzten: der Hunger, die Pestilenz, der Krieg und der allgewaltige Tod. Dieser Vergleich scheint unerhört und völlig entgleist, denn die modernen Mächte gelten als die tragenden Säulen der Menschheitszukunft und haben mit den fratzenhaften Schreckensgestalten, die wir auf alten Bildern Verderben bringend und verwüstend über den Erdkreis jagen sehen, offensichtlich nichts gemein. Und tatsächlich muss man wohl zugestehen, dass ihnen an und für sich nichts Verderbliches anhaftet. Es ist im Gegenteil doch aller Mühen wert, die Natur zu erforschen, die Vorräte zu bewirtschaften, die Arbeit zu erleichtern und das Gemeinwesen zu ordnen. Und dennoch bilden die glorreichen Vier eine unheilige Allianz, die wie einst ihre archaischen Vorgänger einen großen Teil der heute lebenden Menschen mit Hunger, Krieg, Krankheit und Tod bedrohen. Ihre zerstörerischen Kräfte entfalten sie erst dadurch, dass sie in ihrem jeweiligen Geltungsbereich eine Monopolstellung behaupten. Die Naturwissenschaft beansprucht das Monopol der Weltdeutung, die Ökonomie das der Weltverteilung, die Technik das der Weltgestaltung und schließlich die Bürokratie das Monopol, die Welt zu regeln. Zusammengeschlossen und miteinander vernetzt bilden sie eine Supermacht, die ihren Anspruch auf Weltherrschaft weitgehend durchgesetzt hat. Sie tendiert dazu, sich alles anzuverwandeln und alles in sich einzuschließen. Sie duldet keine anderen Götter neben sich.
Monopole sind dazu da, sich in praktizierte Macht umzusetzen. Jedes der vier Monopole ist insbesondere zuständig für eine Handlungsmaxime, die nicht nur das große Weltgeschehen steuert, sondern bis in den Alltag der Menschen Gefolgschaft erzwingt. Der Naturwissenschaft obliegt es, Konsens in Fragen der Welterklärung herzustellen, die Ökonomie sorgt dafür, dass die Konkurrenz alle menschlichen Beziehungen prägt, auch die allerintimsten. Die Technik richtet die Welt auf Konsumierbarkeit zu und erhebt den Konsum zur ausschließlichen Form der Daseinssicherung. Die Bürokratie schließlich stellt Konformität dadurch her, dass sie alle menschlichen Handlungen nach dem Vorbild maschinellen Funktionierens ausrichtet. „Du sollst mit mir eines Sinnes sein und meiner Evidenz trauen“, sagt die Naturwissenschaft. „Du sollst Deinen Nächsten besiegen wollen“, sagt die Ökonomie. „Du sollst die Maschinen statt deiner arbeiten lassen, lass dich bedienen und versorgen“, sagt die Technik. „Das kostet natürlich eine Kleinigkeit“, wirft die Ökonomie ein. „Vor allem sollst du nicht stören“, sagt die Bürokratie.
Erst dadurch allerdings, dass die Monopole zu einem umfassenden System zusammenwachsen, werden ihre Forderungen zu Diktaten, deren Logik so zwingend ist, dass sie gegen nahezu jeden Widerstand immun sind; ja mehr noch: dass sie den Widerstand im Keim ersticken; oder noch genauer: dass der Gedanke, man könnte ihnen widerstehen sollen, verrückt, abwegig oder närrisch erscheint: Sobald sich die Naturwissenschaft mit der Technik liiert, gibt sie jede Zurückhaltung und Selbstbeschränkung auf. Sie begnügt sich nun nicht mehr damit, alleingültig über die Welt Bescheid zu wissen, sondern will maßgeblich daran mitwirken, die Welt zu verändern. Die Ökonomie, die das Duo komplettiert, steuert den Gesichtspunkt der Profitabilität bei. Sie will die Welt verwerten und macht aus der wissenschaftlich-technischen Maschine eine Geldmaschine. Die bürokratische Gleichschaltung aller Machenschaften schließlich erzeugt jene unwiderstehlichen Sachzwänge, gegen die aufzubegehren so nutzlos ist, wie den Mond anzubellen.
„Man kann von der Klaustrophobie der Menschheit in der verwalteten Welt reden, einem Gefühl des Eingesperrtseins in einem (...) netzhaft dicht gesponnenen Zusammenhang. Je dichter das Netz, desto mehr will man heraus, während gerade seine Dichte verwehrt, dass man herauskann“.²
Adorno hat darin recht: wir sind eingesperrt. Aber er hat Unrecht in der Annahme, dass diese Verbarrikadierung mehrheitlich Fluchtimpulse auslöst. Die Klaustrophoben, die ›nichts-wie-raus-hier‹ wollen, sind eine kleine Minorität. Die überwiegende Mehrheit der Ambitionierten will nicht raus, sondern rein und hält sich etwas darauf zugute, bestens ›integriert‹ zu sein. Der Moloch erfährt viel Zustimmung und Bejahung. Und nicht die Furcht, von ihm verschlungen zu werden, sondern die Furcht, von ihm ausgespien zu werden, beherrscht die Systeminsassen.
Die Betreiber des laufenden Irrsinns sind übermächtig. Woher könnten angesichts dieser Übermacht Impulse zum Aufhören kommen? Mit dem ›Aufhören‹ hat es in der deutschen Sprache eine eigentümliche Bewandtnis. Dasselbe Wort steht für zwei scheinbar ganz verschiedene Tätigkeiten. Gewöhnlich benutzen wir das Verb ›aufhören‹ in der Bedeutung von beenden, Schluss machen, finire. Aber meint auch ›auf etwas hören‹, aufhorchen, audire. Das mag uns verwirren. Das ›Aufhören‹ (finire) scheint kraftvollere, entschlossenere, aktivere Maßnahmen zu erfordern, als unsere Ohren sie zuwege bringen, die nur etwas empfangen, aber nichts machen können. Die Ohren erscheinen uns vielleicht als die schwächsten Sinnesorgane und doch haben unsere sprachschöpferischen Ahnen gerade ihnen das Aufhören-Können anvertraut. Wenn wir uns aber die Gebärde des s, des Lauschens vergegenwärtigen, dann erfordert sie tatsächlich ein Innehalten. Wer lauscht, bleibt wie angewurzelt stehen, ist wie vom Blitz getroffen. Er ist, alle Geschäftigkeit unterbrechend, ganz Ohr. In der deutschen Sprache können wir also, ohne tautologisch zu sein, sagen: Um zu können, muss man.
Wenn wir diesem Satz trauen, dann käme es nicht darauf an, es besser zu machen, sondern darauf, es besser zu lassen, es bleiben zu lassen. Um aufhören zu können, ist nicht die Kunst des Bewirkens immer weiter zu raffinieren, sondern die Kunst des Unterlassens zu üben, denn das ist an sich bereits eine Unterbrechung der Gewalt.
Worauf müssten wir also hören, um aufhören zu können? Auf das, womit aufzuhören wäre. In unserem Fall: auf Müll. Und was würden wir zu hören kriegen, wenn wir auf den Müll hören? Wir würden hören, dass Müll nicht sättigt, nicht nährt und nicht zufriedenstellt. Auf diese deprimierende Botschaft gibt es zwei mögliche Reaktionen. Die eine ist die sattsam bekannte. Wenn das, was die Industriegesellschaft als ihren Reichtum hervorbringt, ein Fehlschlag ist, dann muss man eben die Produkte verbessern, optimieren und raffinieren, also Besseres vom Gleichen produzieren, nach dem Grundsatz: „Wir irren uns empor“. Die andere ist radikal: Wenn das, was die Industriegesellschaft produziert, Müll ist, dann ist es der Mühe nicht wert; dann kann man es nicht brauchen, man braucht es aber dann auch nicht mehr. Der Müll wird entzaubert und diese Entzauberung entlässt uns in eine unerhörte Freiheit, die Freiheit, etwas nicht zu gebrauchen. Um aufhören zu können, müssten wir uns also
1. der Einsicht stellen, dass die Wachstumsgesellschaft unfähig ist, etwas anderes als Müll zu produzieren. Das worauf sich alle Rettungsbemühungen richten: die unablässige technische und bürokratische Innovation, müsste als der Kern des Übels erkannt werden. Die moderne Gestalt des Bösen ist nicht dämonisch, aber auch nicht nur banal, wie Hannah Arendt feststellt, sie ist innovativ. Wir müssten uns
2. der Erkenntnis stellen, dass das Kartell der großen Vier jeden Versuch, ihm etwas entgegenzusetzen, das nicht aus seinem Geist ist, mit unerbittlicher Strenge und freundlichem Gesicht durch Integration unschädlich macht. Die heute korrekte politische Forderung in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen lautet ›Integration‹, im soziologischen Uniquak: Inklusion. Was für eine willfährige Zuarbeit für ein alles verschlingendes, gefräßiges System! Ich plädiere für eine andere Bewegungsrichtung: Desintegration oder genauer noch Desertion.
3. scheint mir die Sorge um die Weltrettung nicht hilfreich, wenn wir uns in der Kunst des Aufhörens üben wollen. Niemand kann die Welt retten. Wer sich auf diesen Weg begibt, wird zwangsläufig frustriert. Die Empörung über die Freiheitsberaubung, die uns in den reichen Gesellschaften tagtäglich im Namen von Konsens, Konsum, Konkurrenz und Konformität und mit dem Versprechen von Sicherheit, von Zeitersparnis und von Bequemlichkeit und Anerkennung angetan wird, ist ein weit besserer Ratgeber. Gegen die Freiheitsberaubung kann ich opponieren mit einem unmissverständlichen ›Es reicht!‹ Diese knappen beiden Worte die zugleich vom Genug und von einer unerträglichen Zumutung sprechen, sind das beste, was wir im Gepäck haben, wenn wir aufhören wollen.
4. „Es gibt immer Orte zu finden, die leer von Macht sind. Die institutionelle Umklammerung des Lebens ist zu Anteilen Schein“,³ schrieb Peter Brückner sogar über die Zeit des Nationalsozialismus. Man müsste die Stirn haben, die Allmacht des Systems zu ignorieren. „Bange machen gilt nicht!“ war eine Art Zauberformel unserer Kindheit, mit der wir einen übermächtigen Gegner ›entwaffneten‹ und uns selbst Mut zusprachen. Wenn wir – und sei es in kritischer Absicht – die Totalität des Systems beschwören, sind wir ihm genauso verfallen, als wenn wir uns willig darein fügen. Es käme darauf an, seine enorme Macht zu erkennen, ohne sie anzuerkennen. Aber wie geht das?
Womöglich sind heute Orte, leer von Macht, Nischen, Abseitse, nicht mehr zu finden, sondern erst zu gründen. Das Abseits ist ein Ort für Deserteure. Der Deserteur ist der ›Nicht-mehr-Mitmacher‹ par excellence; er ist Befehlsverweigerer, er entzieht dem Machthaber seine Mittäterschaft, indem er sich heimlich still und leise, vor allem aber unerlaubt von der Truppe entfernt. Er gilt darum als feige, aber das kann ihm egal sein.
Was sind das für Orte, die leer sind von Macht? Es ist nicht von Ungefähr, dass sich so gar nichts Genaues darüber sagen lässt. Denn Orte, leer von Macht, entstehen erst dadurch, dass da Menschen sind, die sie mit ihrer Anwesenheit füllen. Sie sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie besiedeln. Sie werden aus einer tiefen Abneigung gegen Gleichmacherei, Vereinheitlichung und Reih und Glied erschaffen. Es sind Stätten, in denen Menschen so zusammenwirken, dass nicht alles, was man zum Leben braucht, Geld kostet. Was umsonst ist, hat dort einen größeren Wert, als was man kaufen muss. Fürsorge ist wichtiger als Vorsorge. Kooperation und Teilen sind existenznotwendig, ebenso wie das Zusammenspiel verschiedenster Könnerschaften und Talente. Das, was das Abseits aus dem Blickwinkel derer, die um Integration kämpfen, bedrohlich macht, erscheint den Systemdeserteuren gerade als das Rettende. Ihre Nicht- Zugehörigkeit verheißt ihnen ein Stück Freiheit, – jene Haltung, die nichts begehrt von dem, was die Macht verwaltet, am allerwenigsten die Macht selbst – gilt ihnen als radikale Form des Widerstandes. Sie fordern ein Recht auf Armut inmitten einer vom Immer-Mehr gepeitschten Gesellschaft. Zeit ist im Abseits nicht Geld, sondern Zeit. Und Arbeit ist nicht Lohnknechtschaft sondern Eigenarbeit.
Die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke hat einen Roman geschrieben, dessen Titel schon eine Rebellion gegen die Allmacht des Systems ist: „Das lässt sich ändern“. Das ist eine wiederkehrende Aussage des Protagonisten angesichts auftretender Schwierigkeiten in den Alltagsroutinen. Von Adam, so heißt er, wird schon gleich auf der ersten Seite gesagt, dass er „immer schon draußen“ war. Eigentlich müsste man ihn einen Langzeitarbeitslosen nennen, wenn er nicht so unglaublich viel zu tun hätte. Der ganze Roman liest sich wie eine Anleitung zur „allmählichen Verfertigung des Abseits beim Tun“. Adam wusste ziemlich genau, worauf es dabei ankommt: Man muss – erstens – strikt darauf achten, nicht zu „vertrotteln“. Das ist gar nicht so einfach, denn „du wirst sehen, in zwanzig Jahren haben sie uns alle so weit verblödet, dass wir nur noch Knöpfe drücken können (…) und zu blöd zum Kartoffelschälen wären und nicht einmal mehr einen Knopf würden annähen können.“ Man muss – zweitens – eine Art Sperrmüllgesinnung ausbilden, gute Dinge, solche die brauchbar, haltbar, nicht elektronisch verseucht und keine Energiefresser sind, bewahren und sich in ihrem Gebrauch üben: „Er konnte an keinem Sperrmüll vorbei, ohne nachzusehen, ob etwas drin wäre, ein Werkzeug, ein Hobel, ein Ersatzteil, eine angebrochene Rolle doppelseitiges Klebeband (...) irgendwann würde er es bestimmt brauchen können.“
Man muss – drittens – den Kindern behilflich sein, nicht zu verblöden, indem man sie am Ernst des Lebens teilhaben lässt, statt sie in den Schonraum einer verschulten Kindheit abzuschieben. Und – viertens – muss man sich von Menschen in dem, was man kann, beanspruchen lassen und sie im Gegenzug seinerseits beanspruchen: Verschiedene Vermögen verschiedener Menschen sind zu gegenseitigem und gemeinschaftlichen Nutzen in Umlauf zu bringen. Lauter Attitüden, die nicht sehr populär sind in modernen Lebenszuschnitten und eben deshalb konstitutiv für die Kultur des Abseits. Und für diese Kultur des Abseits lässt sich wiederum viel lernen von dem, was Erich Fromm die „Orientierung am Sein“ genannt hat.
1 Zygmunt Bauman: Verworfenes Leben, Hamburg 2005, S. 42.
2 Theodor W. Adorno: Erziehung nach Auschwitz, in: ders.: Gesammelte Schriften Bd.10/2, Darmstadt 1998, S. 676.
3 Brückner, Peter: Das Abseits als sicherer Ort, Berlin 1982, S. 16f.
4 Birgit Vanderbek: Das lässt sich ändern, 2. Auflage, München/Zürich 2011.
Eine ausführlichere Version des Artikels ist in der Zeitschrift der Internationalen Erich Fromm Gesellschaft erschienen:
„Dem Konsumismus trotzen! Das Abseits als wirtlicher Ort,“ in: Fromm Forum (Deutsche Ausgabe – ISBN 1437-0956) 17 / 2013, Tübingen (Selbstverlag), pp. 28-34.
Siehe auch hier
Wenn der Wert eines beliebigen Gegenstandes darin besteht, brandneu zu sein, der letzte Schrei, die Überbietung alles bisher Dagewesenen, dann ist er in demselben Moment, in dem er auf den Plan tritt, bereits im freien Wertverfall begriffen, denn er ist ja nur die Vorstufe des neueren Neuesten, das ihm folgt, er trägt den Makel des Überholten und Defizienten bereits in sich, bevor er zum Zuge kommen kann. In unseren allergeordnetsten Verhältnissen sind wir Müllbewohner, denn wir wohnen inmitten von Dingen, Ideen, Erfahrungen und Fähigkeiten, die kaum, dass das Licht der Welt sie gesehen hat, schon zum alten Eisen gehören.
Wollte man die moderne industrielle Gesellschaft auf einen Begriff bringen, dann könnte man sie als müllgenerierende Gesellschaft bezeichnen. Das, was wir gedankenlos ›Fortschritt‹ nennen, ist die rasant beschleunigte Umwandlung unserer Welt in Müll, der dann seinerseits das einzig Beständige ist. Was Erich Fromm in den 70er Jahren die ›Orientierung am Haben‹ nannte, bildet die Befindlichkeit des modernen von der Vermüllung gezeichneten Konsumenten nur noch unzureichend ab.
Nicht nur die sachlichen Produkte, sondern auch Dienstleistungen aller Art, auch die ›edlen‹ lehrenden, heilenden und helfenden, tragen in dem Maße, in dem sie gewinnträchtig sein sollen, ihren Teil zur Vermüllung unserer Verhältnisse bei. Auch sie sind nicht dazu ausersehen zu helfen oder Abhilfe zu schaffen, sondern dazu, die allgemeine Hilflosigkeit zu mehren und Versorgungsbedürftigkeit zu schüren.
Die warenförmigen Produkte, die die Industriegesellschaft unter der Maßgabe, dass Wachstum sein müsse, ausspuckt, leiden ausnahmslos an einem eklatanten Mangel an Brauchbarkeit und Haltbarkeit. Nun ist aber gerade Haltbarkeit, die Fähigkeit, zu überdauern und hartnäckig der Zersetzung und der Wiedereingliederung in die Naturkreisläufe zu widerstehen, eine hervorstechende Eigenschaft des Mülls. Es ist gerade seine Zähigkeit und Unvergänglichkeit, die uns zu schaffen macht. Wir müssen also unterscheiden zwischen der Haltbarkeit, die einem Gegenstand als Gebrauchsgut eignet und ihn für eine möglichst lange Dauer gegen Verfall und Unbrauchbarkeit resistent macht, und jener, die ihm als Müll anhaftet. Was an den Dingen des Gebrauchs ein hohes Gut ist, nämlich Haltbarkeit, ist am Müll verhängnisvoll.
Der modernste Müll ist demnach nicht der, der auf Deponien lagert, sondern der, der in den Regalen der Kaufhäuser und in den Werbebroschüren der Dienstleistungsindustrie feilgeboten wird, als Müll unkenntlich und deshalb durchaus Objekt der Begierde: „Abfall ist das finstere, schändliche Geheimnis jeglicher Produktion. Es soll vorzugsweise ein Geheimnis bleiben“, schreibt Zygmunt Bauman. ¹
Selbstverständlich ist der real existierende Müll kein Geheimnis; er macht sich sogar drastisch bemerkbar: er stinkt, ist hässlich, ekelerregend, er stört. Er muss weg.
Und so ist man dann auf das ›ressourcenschonende‹ Verfahren des Recycling verfallen. Aber in Wahrheit dient das Recycling dazu, das „finstere, schändliche Geheimnis der Produktion“ zu hüten. Damit etwas recycelt werden kann, muss es ja zuvor aus einem Zyklus herausgeschleudert worden oder daraus ausgebrochen sein. Es trägt die Spuren der Verwüstung bereits in sich. Mehr noch: Recycling ist seinerseits nur eine Etappe in der Produktion weiteren industriellen Mülls, die denselben Gesetzen folgt wie die Produktion selbst: den Gesetzen der Überproduktion und des zerstörerischen Wachstums, der Ersetzung aller Tätigkeit durch Waren, der Verwandlung der Welt in eine globale Deponie im Kampf gegen Langlebigkeit, Brauchbarkeit und Konvivialität. Recycling ist Vermüllung mit gutem Gewissen, es hat seine Unschuld längst verloren. Ich habe den dunklen Verdacht, dass wir auch dem finsteren Geheimnis der ›Nachhaltigkeit‹ noch lange nicht auf der Spur sind.
Wie lebt es sich in einer müllerzeugenden Gesellschaft? Was wird aus Menschen, deren Arbeit nicht nur zu nichts nütze ist, sondern schweren Schaden anrichtet?
Wie wirkt sich die Tatsache, dass wir uns in einer Welt aus Müll einrichten müssen, auf unser Weltempfinden und unser Befinden aus? Zunächst einmal so, dass wir uns in ihr überhaupt nicht einrichten können. Das, was Hannah Arendt als den Lohn des „Her-stellens“ erkennt, dass nämlich dabei eine Welt aus Dingen entsteht, die dauerhafter sind als wir selbst und in der wir deshalb Halt und Haltung finden können, gilt nicht für die industrielle Produktion. Die erschafft eine Welt, in der das Allerneueste am erstrebenswertesten ist. In ihr kann man sich guten Gewissens für nichts mehr entscheiden, weil jede Entscheidung für etwas mich nötigt, mich mit Defizitärem zu begnügen, und mich um die Möglichkeit bringt, dem demnächst Allerneuesten den Zuschlag zu geben. Selbst die unschuldig geglaubten Ökoprodukte entgehen dem Gesetz der Vermüllung nicht: Ist es nicht voreilig oder unvernünftig, die Sonnenenergieanlage auf mein Dach zu setzen, die heute die am weitesten entwickelte ist, wenn doch morgen die Entwicklung darüber hingegangen sein wird und ich meine finanziellen Ressourcen für etwas hoffnungslos Veraltetes verausgabt habe? Ist es nicht unsinnig, meine Entscheidung auf ein Wissen zu gründen, das morgen überholt sein wird. Ist es nicht verrückt, Zeit und Kraft in eine Bildung zu investieren, die morgen karrierehinderlich ist? Ist es nicht unverantwortlich, heute an etwas zu glauben, das morgen als schierer Aberglaube entlarvt sein wird. Jede ergriffene Chance ist eine Niederlage, jede getroffene Entscheidung ist eine Entscheidung für Müll. Sie verwandelt eine Verheißung in eine Verfehlung und Enttäuschung.
Es gibt immer mehr Dinge, die nicht vergehen können. Müll ist ›unverweslich‹. Aber noch beharrlicher als der Müll selbst ist die Monokultur der Müllgesinnung. Monokulturen und Monopole bedingen sich gegenseitig. Es sind mächtige Monopole, die dafür Sorge tragen, dass das schändliche Geheimnis der Wachstumsgesellschaft – dass sie nämlich Müll produziert und konsumiert – nicht ruchbar wird und dass das „Weiter-So“ seinen ungehinderten Lauf nimmt. Es sind jene treibenden Kräfte, die den Fortschritt garantieren: die Naturwissenschaft, die Ökonomie, die Technik und die Bürokratie.
In seinem Geltungsanspruch ist dieses Quartett so gebieterisch wie einst die apokalyptischen Reiter, die allerdings ganz andere Namen trugen und die mittelalterlichen Menschen in Angst und Schrecken versetzten: der Hunger, die Pestilenz, der Krieg und der allgewaltige Tod. Dieser Vergleich scheint unerhört und völlig entgleist, denn die modernen Mächte gelten als die tragenden Säulen der Menschheitszukunft und haben mit den fratzenhaften Schreckensgestalten, die wir auf alten Bildern Verderben bringend und verwüstend über den Erdkreis jagen sehen, offensichtlich nichts gemein. Und tatsächlich muss man wohl zugestehen, dass ihnen an und für sich nichts Verderbliches anhaftet. Es ist im Gegenteil doch aller Mühen wert, die Natur zu erforschen, die Vorräte zu bewirtschaften, die Arbeit zu erleichtern und das Gemeinwesen zu ordnen. Und dennoch bilden die glorreichen Vier eine unheilige Allianz, die wie einst ihre archaischen Vorgänger einen großen Teil der heute lebenden Menschen mit Hunger, Krieg, Krankheit und Tod bedrohen. Ihre zerstörerischen Kräfte entfalten sie erst dadurch, dass sie in ihrem jeweiligen Geltungsbereich eine Monopolstellung behaupten. Die Naturwissenschaft beansprucht das Monopol der Weltdeutung, die Ökonomie das der Weltverteilung, die Technik das der Weltgestaltung und schließlich die Bürokratie das Monopol, die Welt zu regeln. Zusammengeschlossen und miteinander vernetzt bilden sie eine Supermacht, die ihren Anspruch auf Weltherrschaft weitgehend durchgesetzt hat. Sie tendiert dazu, sich alles anzuverwandeln und alles in sich einzuschließen. Sie duldet keine anderen Götter neben sich.
Monopole sind dazu da, sich in praktizierte Macht umzusetzen. Jedes der vier Monopole ist insbesondere zuständig für eine Handlungsmaxime, die nicht nur das große Weltgeschehen steuert, sondern bis in den Alltag der Menschen Gefolgschaft erzwingt. Der Naturwissenschaft obliegt es, Konsens in Fragen der Welterklärung herzustellen, die Ökonomie sorgt dafür, dass die Konkurrenz alle menschlichen Beziehungen prägt, auch die allerintimsten. Die Technik richtet die Welt auf Konsumierbarkeit zu und erhebt den Konsum zur ausschließlichen Form der Daseinssicherung. Die Bürokratie schließlich stellt Konformität dadurch her, dass sie alle menschlichen Handlungen nach dem Vorbild maschinellen Funktionierens ausrichtet. „Du sollst mit mir eines Sinnes sein und meiner Evidenz trauen“, sagt die Naturwissenschaft. „Du sollst Deinen Nächsten besiegen wollen“, sagt die Ökonomie. „Du sollst die Maschinen statt deiner arbeiten lassen, lass dich bedienen und versorgen“, sagt die Technik. „Das kostet natürlich eine Kleinigkeit“, wirft die Ökonomie ein. „Vor allem sollst du nicht stören“, sagt die Bürokratie.
Erst dadurch allerdings, dass die Monopole zu einem umfassenden System zusammenwachsen, werden ihre Forderungen zu Diktaten, deren Logik so zwingend ist, dass sie gegen nahezu jeden Widerstand immun sind; ja mehr noch: dass sie den Widerstand im Keim ersticken; oder noch genauer: dass der Gedanke, man könnte ihnen widerstehen sollen, verrückt, abwegig oder närrisch erscheint: Sobald sich die Naturwissenschaft mit der Technik liiert, gibt sie jede Zurückhaltung und Selbstbeschränkung auf. Sie begnügt sich nun nicht mehr damit, alleingültig über die Welt Bescheid zu wissen, sondern will maßgeblich daran mitwirken, die Welt zu verändern. Die Ökonomie, die das Duo komplettiert, steuert den Gesichtspunkt der Profitabilität bei. Sie will die Welt verwerten und macht aus der wissenschaftlich-technischen Maschine eine Geldmaschine. Die bürokratische Gleichschaltung aller Machenschaften schließlich erzeugt jene unwiderstehlichen Sachzwänge, gegen die aufzubegehren so nutzlos ist, wie den Mond anzubellen.
„Man kann von der Klaustrophobie der Menschheit in der verwalteten Welt reden, einem Gefühl des Eingesperrtseins in einem (...) netzhaft dicht gesponnenen Zusammenhang. Je dichter das Netz, desto mehr will man heraus, während gerade seine Dichte verwehrt, dass man herauskann“.²
Adorno hat darin recht: wir sind eingesperrt. Aber er hat Unrecht in der Annahme, dass diese Verbarrikadierung mehrheitlich Fluchtimpulse auslöst. Die Klaustrophoben, die ›nichts-wie-raus-hier‹ wollen, sind eine kleine Minorität. Die überwiegende Mehrheit der Ambitionierten will nicht raus, sondern rein und hält sich etwas darauf zugute, bestens ›integriert‹ zu sein. Der Moloch erfährt viel Zustimmung und Bejahung. Und nicht die Furcht, von ihm verschlungen zu werden, sondern die Furcht, von ihm ausgespien zu werden, beherrscht die Systeminsassen.
Die Betreiber des laufenden Irrsinns sind übermächtig. Woher könnten angesichts dieser Übermacht Impulse zum Aufhören kommen? Mit dem ›Aufhören‹ hat es in der deutschen Sprache eine eigentümliche Bewandtnis. Dasselbe Wort steht für zwei scheinbar ganz verschiedene Tätigkeiten. Gewöhnlich benutzen wir das Verb ›aufhören‹ in der Bedeutung von beenden, Schluss machen, finire. Aber meint auch ›auf etwas hören‹, aufhorchen, audire. Das mag uns verwirren. Das ›Aufhören‹ (finire) scheint kraftvollere, entschlossenere, aktivere Maßnahmen zu erfordern, als unsere Ohren sie zuwege bringen, die nur etwas empfangen, aber nichts machen können. Die Ohren erscheinen uns vielleicht als die schwächsten Sinnesorgane und doch haben unsere sprachschöpferischen Ahnen gerade ihnen das Aufhören-Können anvertraut. Wenn wir uns aber die Gebärde des s, des Lauschens vergegenwärtigen, dann erfordert sie tatsächlich ein Innehalten. Wer lauscht, bleibt wie angewurzelt stehen, ist wie vom Blitz getroffen. Er ist, alle Geschäftigkeit unterbrechend, ganz Ohr. In der deutschen Sprache können wir also, ohne tautologisch zu sein, sagen: Um zu können, muss man.
Wenn wir diesem Satz trauen, dann käme es nicht darauf an, es besser zu machen, sondern darauf, es besser zu lassen, es bleiben zu lassen. Um aufhören zu können, ist nicht die Kunst des Bewirkens immer weiter zu raffinieren, sondern die Kunst des Unterlassens zu üben, denn das ist an sich bereits eine Unterbrechung der Gewalt.
Worauf müssten wir also hören, um aufhören zu können? Auf das, womit aufzuhören wäre. In unserem Fall: auf Müll. Und was würden wir zu hören kriegen, wenn wir auf den Müll hören? Wir würden hören, dass Müll nicht sättigt, nicht nährt und nicht zufriedenstellt. Auf diese deprimierende Botschaft gibt es zwei mögliche Reaktionen. Die eine ist die sattsam bekannte. Wenn das, was die Industriegesellschaft als ihren Reichtum hervorbringt, ein Fehlschlag ist, dann muss man eben die Produkte verbessern, optimieren und raffinieren, also Besseres vom Gleichen produzieren, nach dem Grundsatz: „Wir irren uns empor“. Die andere ist radikal: Wenn das, was die Industriegesellschaft produziert, Müll ist, dann ist es der Mühe nicht wert; dann kann man es nicht brauchen, man braucht es aber dann auch nicht mehr. Der Müll wird entzaubert und diese Entzauberung entlässt uns in eine unerhörte Freiheit, die Freiheit, etwas nicht zu gebrauchen. Um aufhören zu können, müssten wir uns also
1. der Einsicht stellen, dass die Wachstumsgesellschaft unfähig ist, etwas anderes als Müll zu produzieren. Das worauf sich alle Rettungsbemühungen richten: die unablässige technische und bürokratische Innovation, müsste als der Kern des Übels erkannt werden. Die moderne Gestalt des Bösen ist nicht dämonisch, aber auch nicht nur banal, wie Hannah Arendt feststellt, sie ist innovativ. Wir müssten uns
2. der Erkenntnis stellen, dass das Kartell der großen Vier jeden Versuch, ihm etwas entgegenzusetzen, das nicht aus seinem Geist ist, mit unerbittlicher Strenge und freundlichem Gesicht durch Integration unschädlich macht. Die heute korrekte politische Forderung in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen lautet ›Integration‹, im soziologischen Uniquak: Inklusion. Was für eine willfährige Zuarbeit für ein alles verschlingendes, gefräßiges System! Ich plädiere für eine andere Bewegungsrichtung: Desintegration oder genauer noch Desertion.
3. scheint mir die Sorge um die Weltrettung nicht hilfreich, wenn wir uns in der Kunst des Aufhörens üben wollen. Niemand kann die Welt retten. Wer sich auf diesen Weg begibt, wird zwangsläufig frustriert. Die Empörung über die Freiheitsberaubung, die uns in den reichen Gesellschaften tagtäglich im Namen von Konsens, Konsum, Konkurrenz und Konformität und mit dem Versprechen von Sicherheit, von Zeitersparnis und von Bequemlichkeit und Anerkennung angetan wird, ist ein weit besserer Ratgeber. Gegen die Freiheitsberaubung kann ich opponieren mit einem unmissverständlichen ›Es reicht!‹ Diese knappen beiden Worte die zugleich vom Genug und von einer unerträglichen Zumutung sprechen, sind das beste, was wir im Gepäck haben, wenn wir aufhören wollen.
4. „Es gibt immer Orte zu finden, die leer von Macht sind. Die institutionelle Umklammerung des Lebens ist zu Anteilen Schein“,³ schrieb Peter Brückner sogar über die Zeit des Nationalsozialismus. Man müsste die Stirn haben, die Allmacht des Systems zu ignorieren. „Bange machen gilt nicht!“ war eine Art Zauberformel unserer Kindheit, mit der wir einen übermächtigen Gegner ›entwaffneten‹ und uns selbst Mut zusprachen. Wenn wir – und sei es in kritischer Absicht – die Totalität des Systems beschwören, sind wir ihm genauso verfallen, als wenn wir uns willig darein fügen. Es käme darauf an, seine enorme Macht zu erkennen, ohne sie anzuerkennen. Aber wie geht das?
Womöglich sind heute Orte, leer von Macht, Nischen, Abseitse, nicht mehr zu finden, sondern erst zu gründen. Das Abseits ist ein Ort für Deserteure. Der Deserteur ist der ›Nicht-mehr-Mitmacher‹ par excellence; er ist Befehlsverweigerer, er entzieht dem Machthaber seine Mittäterschaft, indem er sich heimlich still und leise, vor allem aber unerlaubt von der Truppe entfernt. Er gilt darum als feige, aber das kann ihm egal sein.
Was sind das für Orte, die leer sind von Macht? Es ist nicht von Ungefähr, dass sich so gar nichts Genaues darüber sagen lässt. Denn Orte, leer von Macht, entstehen erst dadurch, dass da Menschen sind, die sie mit ihrer Anwesenheit füllen. Sie sind so unterschiedlich wie die Menschen, die sie besiedeln. Sie werden aus einer tiefen Abneigung gegen Gleichmacherei, Vereinheitlichung und Reih und Glied erschaffen. Es sind Stätten, in denen Menschen so zusammenwirken, dass nicht alles, was man zum Leben braucht, Geld kostet. Was umsonst ist, hat dort einen größeren Wert, als was man kaufen muss. Fürsorge ist wichtiger als Vorsorge. Kooperation und Teilen sind existenznotwendig, ebenso wie das Zusammenspiel verschiedenster Könnerschaften und Talente. Das, was das Abseits aus dem Blickwinkel derer, die um Integration kämpfen, bedrohlich macht, erscheint den Systemdeserteuren gerade als das Rettende. Ihre Nicht- Zugehörigkeit verheißt ihnen ein Stück Freiheit, – jene Haltung, die nichts begehrt von dem, was die Macht verwaltet, am allerwenigsten die Macht selbst – gilt ihnen als radikale Form des Widerstandes. Sie fordern ein Recht auf Armut inmitten einer vom Immer-Mehr gepeitschten Gesellschaft. Zeit ist im Abseits nicht Geld, sondern Zeit. Und Arbeit ist nicht Lohnknechtschaft sondern Eigenarbeit.
Die Schriftstellerin Birgit Vanderbeke hat einen Roman geschrieben, dessen Titel schon eine Rebellion gegen die Allmacht des Systems ist: „Das lässt sich ändern“. Das ist eine wiederkehrende Aussage des Protagonisten angesichts auftretender Schwierigkeiten in den Alltagsroutinen. Von Adam, so heißt er, wird schon gleich auf der ersten Seite gesagt, dass er „immer schon draußen“ war. Eigentlich müsste man ihn einen Langzeitarbeitslosen nennen, wenn er nicht so unglaublich viel zu tun hätte. Der ganze Roman liest sich wie eine Anleitung zur „allmählichen Verfertigung des Abseits beim Tun“. Adam wusste ziemlich genau, worauf es dabei ankommt: Man muss – erstens – strikt darauf achten, nicht zu „vertrotteln“. Das ist gar nicht so einfach, denn „du wirst sehen, in zwanzig Jahren haben sie uns alle so weit verblödet, dass wir nur noch Knöpfe drücken können (…) und zu blöd zum Kartoffelschälen wären und nicht einmal mehr einen Knopf würden annähen können.“ Man muss – zweitens – eine Art Sperrmüllgesinnung ausbilden, gute Dinge, solche die brauchbar, haltbar, nicht elektronisch verseucht und keine Energiefresser sind, bewahren und sich in ihrem Gebrauch üben: „Er konnte an keinem Sperrmüll vorbei, ohne nachzusehen, ob etwas drin wäre, ein Werkzeug, ein Hobel, ein Ersatzteil, eine angebrochene Rolle doppelseitiges Klebeband (...) irgendwann würde er es bestimmt brauchen können.“
Man muss – drittens – den Kindern behilflich sein, nicht zu verblöden, indem man sie am Ernst des Lebens teilhaben lässt, statt sie in den Schonraum einer verschulten Kindheit abzuschieben. Und – viertens – muss man sich von Menschen in dem, was man kann, beanspruchen lassen und sie im Gegenzug seinerseits beanspruchen: Verschiedene Vermögen verschiedener Menschen sind zu gegenseitigem und gemeinschaftlichen Nutzen in Umlauf zu bringen. Lauter Attitüden, die nicht sehr populär sind in modernen Lebenszuschnitten und eben deshalb konstitutiv für die Kultur des Abseits. Und für diese Kultur des Abseits lässt sich wiederum viel lernen von dem, was Erich Fromm die „Orientierung am Sein“ genannt hat.
1 Zygmunt Bauman: Verworfenes Leben, Hamburg 2005, S. 42.
2 Theodor W. Adorno: Erziehung nach Auschwitz, in: ders.: Gesammelte Schriften Bd.10/2, Darmstadt 1998, S. 676.
3 Brückner, Peter: Das Abseits als sicherer Ort, Berlin 1982, S. 16f.
4 Birgit Vanderbek: Das lässt sich ändern, 2. Auflage, München/Zürich 2011.
Eine ausführlichere Version des Artikels ist in der Zeitschrift der Internationalen Erich Fromm Gesellschaft erschienen:
„Dem Konsumismus trotzen! Das Abseits als wirtlicher Ort,“ in: Fromm Forum (Deutsche Ausgabe – ISBN 1437-0956) 17 / 2013, Tübingen (Selbstverlag), pp. 28-34.
Siehe auch hier